Dann kam der Shutdown, persönliche Begegnungen wurden stark eingeschränkt. Zu den Fragen nach der Reaktion des Kunstbetriebs auf den Klimawandel kamen jene nach der Corona-Krise: Wie wird sich diese auswirken? Zeichnet sich ab, ob die Kunst daraus etwas lernen kann? Neben Andraschek baten wir die Leiterin des Kunsthauses Wien, Bettina Leidl, sowie ihre Kollegin vom Kunstraum Niederösterreich, Katharina Brandl, zum virtuellen Round Table.
Kunst und Klima
„Wir wissen, welche Katastrophen auf uns warten“
Dieses Gespräch war, wie so vieles dieser Tage, anders geplant. Eigentlich sollte es im Atelier der Künstlerin Iris Andraschek stattfinden.
morgen: Die Corona-Krise hat aktuell alle Lebensbereiche erfasst. Zeigt sie uns, was wir brauchen und was nicht?
Iris Andraschek
:Am Anfang des Rückzugs dachte ich mir, jetzt hätte ich mehr Zeit, mich aufs Wesentliche zu konzentrieren. Doch nun wird die Frage virulent, wie es weitergehen soll. Es ist eine Chance, Dinge zu überdenken. Aber für den Kunstbetrieb ist das momentan sehr existenziell. Wie kompensiert man die Ausfälle, wie wird die Zukunft ausschauen?
Katharina Brandl
:Die Krise betrifft eine Künstlerin oder Menschen aus einem institutionellen Kontext wie mich ganz anders als zum Beispiel den Markt der Kunstmessen, der globalisiert ist. Ohne das Zusammentreffen von Menschen und die reale Rezeption von Kunst können wir aber nicht leben.
Bettina Leidl
:Mit dem Homeoffice habe ich so meine Probleme, ich sitze lieber weiterhin im Büro. Ich brauche dieses Umfeld, um strukturiert arbeiten zu können. Wenn der Austausch wegbricht, kann man auch keine neuen Pläne schmieden. Es gibt im ganzen Kunstbereich in der Zwischenzeit tolle digitale Angebote und Projekte. Aber sie sind kein Ersatz für das, was wir wirklich machen wollen, nämlich mit Künstlerinnen und Künstlern zu arbeiten.
Momentan sind wir sehr eingeschränkt, was unsere Reisen betrifft. Das lässt sich bereits jetzt am CO2-Ausstoß messen. Wenn Reisebeschränkungen länger dauern, was bedeutet das für den globalen Kunstbetrieb?
Brandl
:Mein Lebensmodell baut darauf auf, dass ich reisen kann – vor allem zwischen Wien und Basel, wo ich an der Uni lehre. Ich kann mir vorstellen, jeweils länger an einem Ort zu bleiben. Das würde die Reisefrequenz reduzieren. Ich bin gespannt auf die Klimadaten aufgrund des fehlenden Flugverkehrs. Andererseits verbrauchen wir viel mehr durch Dienste wie Zoom: Große Serverfarmen stoßen extrem viel CO2 aus. Das Reisen ist nur einer von vielen Faktoren.
Leidl
:Ich fürchte, dass die Corona-Krise den Klimaproblemen die Aufmerksamkeit entzieht. Wenn wir nicht jetzt intensiv über neue Formen des Zusammenlebens nachdenken, werden wir bald in unser altes System zurückfallen. Das sieht man am Beispiel großer Kulturveranstaltungen: Man verschiebt sie einfach um ein paar Monate, anstatt über neue Formen der Präsentation nachzudenken. Das ist bei der Art Basel so, aber auch bei der Architekturbiennale. Müssen wir wirklich aus der ganzen Welt anreisen, um uns die neueste Kunst oder Architektur anzusehen? Bemerkenswert finde ich, dass wir gerade eine starke generationenübergreifende Verantwortung leben und uns sehr solidarisch gegenüber unseren Mitmenschen verhalten, damit die Schwächeren unserer Gesellschaft diese Krise überleben.
Andraschek
:Dem pflichte ich bei. Was mir abgeht, ist die Verknüpfung mit der Klimafrage. Auch ich habe das mulmige Gefühl, dass Klimafragen nicht mehr die Nummer eins sein werden, wenn die Corona-Krise überstanden ist.
Leidl
:Ich fürchte, die Politik wird nach der Corona-Krise viel weniger Klimaschutzmaßnahmen von der Wirtschaft einfordern – mit dem Argument, dass jetzt ohnehin so große Opfer gebracht wurden.
Brandl
:An der Corona-Krise sieht man, dass wir global gewisse Risiken hinnehmen. Seit spätestens 2007 gibt es auch dokumentierte, wissenschaftliche Warnungen vor genau jener Situation, in die wir hineingeschlittert sind: vor der Gefahr der Ansteckung des Menschen mit neuen Coronaviren, die insbesondere durch den Verkauf von lebenden Wildtieren begünstigt wird. Ebenso wissen wir, welche Klimakatastrophen auf uns warten, bei denen wahrscheinlich noch mehr Leute sterben werden als bei der Pandemie. Wir sehen auch, wie Mensch und Natur zusammenleben – das betrifft das Coronavirus, ebenso Ebola: Wildtiere verlieren ihr Habitat, stecken einander und dann den Menschen an.
Man konnte vor der Corona-Krise den Eindruck gewinnen, dass das Klima in der Kunst ein großes Thema wird. Die Art Basel Miami veranstaltete ein Panel dazu, der Kurator Hans Ulrich Obrist reduzierte medienwirksam seine Flugreisen, Initiativen für grüne Museen sprossen aus dem Boden. Auf der anderen Seite bemerken wir eine räumliche und physische Expansion, die sich mit dem Klimaschutzgedanken nur schwer verträgt, etwa wenn Erwin Wurm in Russland eine riesige Skulptur produzieren und nach Venedig transportieren lässt. Wie nehmt ihr die Haltung der Kunstwelt gegenüber Klimathemen wahr?
Andraschek
:Die Kunst ist frei. Als ich studierte, saßen wir manchmal mit dem Fotokünstler Peter Dressler in der Mensa und diskutierten darüber, dass die Verwendung von Cibachrome in der Fotografie aufgrund der Umweltschädlichkeit eigentlich nicht okay ist. Dressler meinte: Künstler dürfen das! Ich denke, wir sollen selbst entscheiden, was wir machen wollen, und können uns dann der Kritik stellen. Natürlich kann da die Frage auftauchen: Ist es nötig, so viele Ressourcen zu verwenden, um eine bestimmte Sache auszudrücken? Der Betrieb hat sich sehr verändert: Es gibt jetzt riesige Global Players, viele Messen und Biennalen.
Leidl
:Es kommt auf den Kontext an, darauf, was uns die Kunst sagen will, ob sie unsere Wahrnehmung schärft und Perspektiven verändert. Olafur Eliasson brachte 2015 Gletschereis aus Grönland zur Klimakonferenz nach Paris. Das war eine ziemlich umstrittene Kunstaktion, die aber auch extrem beeindruckte. Heute sagt Eliasson, dass er sie wahrscheinlich jetzt nicht mehr so umsetzen würde.
Brandl
:Die Kunst kann Zusammenhänge sichtbar machen. Kleine Institutionen wie der Kunstraum Niederösterreich agieren oft nachhaltig – und zwar einfach aus dem Grund, weil sie es sich nicht anders leisten können. Im Kunstraum zeigen wir zum Beispiel oft Ausstellungskopien, weil wir nicht Originale über Tausende Kilometer schicken können und die Versicherungen zu teuer sind. Wir bauen selten neue Wände ein, die wir nach der Ausstellung wegwerfen müssten. Das ist einerseits eine Frage der finanziellen, andererseits eine der ökologischen Ressourcen. Oft hört man, dass die großen Betriebe vorangehen sollen. Aber für die kleineren ist es häufig viel einfacher, weil sie es schon gelernt haben.
Das Kunsthaus wurde 2018 als erstes Museum mit dem Österreichischen Umweltzeichen (ÖUZ) ausgezeichnet. Bettina Leidl, Sie sind nicht nur dessen Leiterin, sondern sitzen auch der Österreich-Sektion des International Council of Museums (ICOM) vor. Wie sehr steht Nachhaltigkeit auf der Agenda anderer Museen?
Leidl
:Das Kunsthaus Wien hat 2018 seinen Betrieb nachhaltig umgestellt. Das ÖUZ ist eine hochwertige staatliche Zertifizierung, die international sehr positiv wahrgenommen wird. Die Kriterien für die Zertifizierung haben wir zwei Jahre lang mit ICOM Österreich, dem Ökologie-Institut, dem Verein für Konsumentenschutz und dem Umweltministerium erstellt. Dabei war zum Beispiel auch die Restaurierung ein großes Thema, in Hinblick auf den Umgang mit Chemikalien, der nachhaltige Umgang mit Ausstellungsarchitektur, Transporte und Lagerung, Materialienwahl, Mehrfachverwendung, Recycling, Sekundärverwertung und mehr. Doch es war nie Ziel dieser Zertifizierung, dass wir im Regionalen enden und nicht mehr internationale Kunst zeigen können. Was andere Museen betrifft, so war ab dem Sommer 2019 eine große Aufmerksamkeit für das Thema zu bemerken.
Es war nie das Ziel, im Regionalen zu enden.
2019 riefen die britischen Tate Museen sogar den Klimanotstand aus und kündigten an, ihren CO2-Ausstoß bis 2023 um 10 Prozent zu reduzieren. Das hört sich allerdings nicht nach einem besonders ambitionierten Ziel an. Gibt es da Vergleichswerte aus dem Kunsthaus?
Leidl
:Die von den Tate Museen genannte Zahl kommt mir nicht gerade hoch vor. Das Ziel sollte eher sein, dass man klimaneutral agiert. Einige Maßnahmen können Museen ganz schnell setzen, indem sie zum Beispiel chlorfreies Recyclingpapier für Büro, Folder und Einladungskarten verwenden und das Shop-Sortiment auf nachhaltige, unverpackte Produkte lokaler Unternehmen umstellen. Langfristige Maßnahmen – wie etwa Energiesparmaßnahmen, LED- statt Halogenlampen, grüne Energie statt herkömmlicher – sind oft mit großen Investitionen verbunden. Den Museen kommt eine Vorbildfunktion zu, sie sind Werteproduzenten. Wir müssen uns befreien von der Vorstellung, dass Erfolge nur mittels hoher Besucherzahlen gemessen werden. Museen tragen wesentlich zur Orientierung an Demokratie, Menschenrechten, sozialer Gerechtigkeit und ökologischem Bewusstsein bei.



Die Londoner Serpentine Galleries haben eine Kuratorin für Ökologie engagiert, Lucia Pietroiusti. Diese machte kürzlich einen radikalen Vorschlag: Institutionen sollten Umweltprojekte kurzerhand zum Kunstwerk erklären, um diese zu unterstützen. Was ist davon zu halten?
Brandl
:Wenn der ästhetische Wert sehr stark untergeordnet wird und ein solches Projekt einfach als Kunst bezeichnet wird, sehe ich das als problematisch an. Da besteht die Gefahr, dass sich die Kunst ihre eigene Berechtigung nimmt. Außerdem kann sie nicht dort einspringen, wo die Politik keine oder zu wenige Maßnahmen setzt.
Andraschek
:Mir scheint das eine etwas populistische Proklamierung zu sein. Man müsste sich zwar die konkreten Projekte ansehen, aber so pauschal kann man das nicht fordern.
Leidl
:Mir kommt das nicht so neu vor. Die „Wochenklausur“ erklärte beispielsweise bereits in den 1990er-Jahren Sozialarbeit zur Kunst. Das alles wurde häufig diskutiert. Wir gehen anders vor, setzen bei den Klimaprojekten stark auf Kollaborationen mit Fridays for Future und den Scientists for Future.
Brandl
:Es ist außerdem sehr binär gedacht, wenn man meint, dass auf der einen Seite der Klimaaktivismus steht, auf der anderen Seite die Kunst, die sich in sich gekehrt mit dem Klima beschäftigt. Wir kennen erfolgreiche Beispiele, wo das gut zusammengeht. In diesem Zusammenhang fällt mir das Projekt „Grow Your Own Cloud“ ein, das kommt aus der Kunst und wirkt wie ein Critical-Design-Projekt. Da geht es um Cloudserver-Farmen, und man kann sich als Userin selbst beteiligen – nämlich Daten in Pflanzen speichern. Damit wird ein Riesenproblem angesprochen, nämlich der Energieverbrauch durch Speicherkapazitäten.
Auch die Arbeiten von Iris Andraschek sind alles andere als in sich gekehrt. Sie beobachten unter anderem Produzentinnen und Produzenten in der alternativen Landwirtschaft. Wie kam es dazu?
Andraschek
:Als junge Frau lebte ich in einem kleinen Ort in Niederösterreich. Da fiel mir ein Mann auf, der immer im Blauzeug unterwegs war und im Dorf belächelt wurde, weil er ein eigenwilliger Charakter war. Er zog in seinem Garten Gemüse. Darüber unterhielt ich mich mit ihm. Er artikulierte sich anders als andere, mit denen ich über Pflanzen sprach. So begann ich, ihn in der Landschaft zu fotografieren. Diese Fotos stellte ich solchen gegenüber, die ich zufällig fand, offenbar von einem Versicherungsvertreter aufgenommen, zum Beispiel von einem überfahrenen Schwein. Der Umgang mit dem Begriff der Natur interessiert mich schon lange und bildet einen starken Strang in meiner Arbeit, von dem Zwischenthemen und Nebenerzählungen ausgehen. Auch die Qualität der Erzählung interessierte mich: In der Arbeit „Sekundäre Wildnis“ kommt auch eine Bäuerin aus dem Waldviertel vor, die schon seit den 1970er-Jahren biologisch arbeitet – ohne es so zu nennen. Sie machte das aus sich heraus, einfach, weil sie keinen Kunstdünger verwenden und sich nicht dem Diktat der Saatgutindustrie unterwerfen wollte. Ich halte es für viel spannender zu erfahren, wieso jemand einen Weg geht, bei dem weniger Ertrag zu erzielen ist, als wenn mir ein konventioneller Landwirt von seiner Produktion erzählt.
Daran zeigt sich, dass Fragen nach dem Klima immer auch gesellschaftspolitische sind.
Andraschek
:Die Personen, mit denen ich arbeite, leben meist nicht nach einer gesellschaftlichen Norm. Allerdings nicht absichtlich, sondern weil sie ihrem Denken und ihrem Gefühl folgen. Es ist eine radikale, meist einsame Haltung, und sie stehen oft außerhalb.
Brandl
:Dass die Ausbeutung der Natur durch den Menschen immer auch mit der Ausbeutung des Menschen durch den Menschen zusammenhängt: Das zeigt die Ausbreitung des Coronavirus ebenso wie die Klimaproblematik.
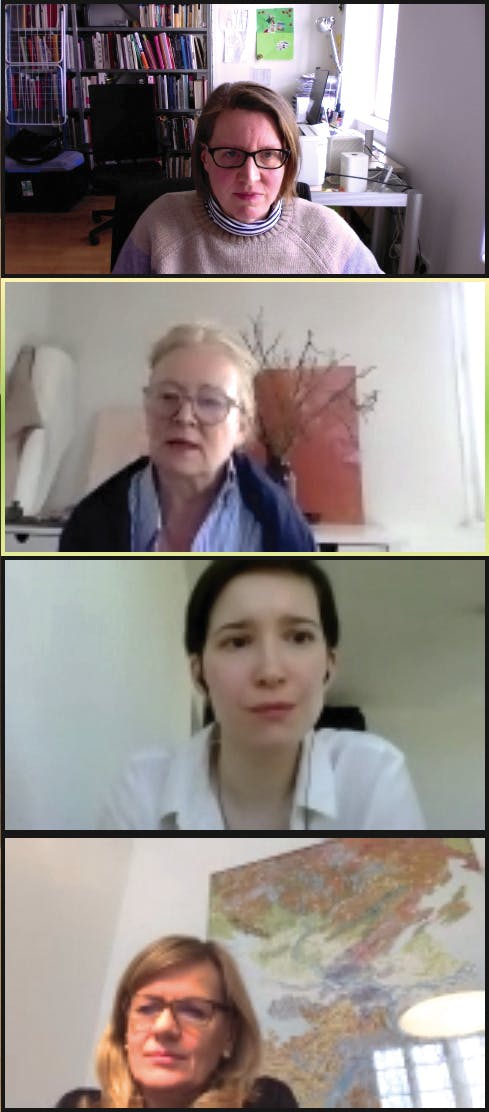
Welche Rolle kann die Kunst im Zusammenhang mit den Krisen, denen wir momentan ausgesetzt sind, spielen?
Leidl
:Kunstschaffende regen gesellschaftspolitische Diskurse an und arbeiten Zusammenhänge heraus. Die Lösung der Klimafrage kann nicht allein Aufgabe der Kunst sein. Jetzt ist es an der Zeit, dass die Politik auch in der Klimakrise weitreichendere Maßnahmen setzt – ich wünsche mir, ähnlich den Bewältigungsstrategien im Rahmen der Corona-Krise, auch in der Klimafrage einen großen gesellschaftspolitischen Schulterschluss.
Brandl
:Die Kunst lehrt uns Ambiguitätstoleranz. In künstlerischen Arbeiten müssen wir das Mehrdeutige und das Ungewisse aushalten. Dasselbe sehen wir jetzt bei der Corona-Krise: Es gibt Maßnahmen, die unangenehm sind, die wir aber verstehen. Die Fähigkeit, Widersprüche auszuhalten und nicht in Schwarz und Weiß zu denken, ist eine wichtige demokratiepolitische Fähigkeit, die uns die Kunst lehrt.
Andraschek
:Es ist eine Herausforderung, künstlerisch auf die aktuelle Lage zu reagieren. Ich habe mich in unser Haus in Mödring bei Horn zurückgezogen und beschäftige mich mit Materialien, Farben und Aggregatszuständen. Schon im März kam ich hierher, an einen Arbeitsplatz, den ich sonst nur im Sommer habe, den ich nicht heizen kann. Wie ist es, wenn man nicht im warmen Atelier sitzt? Dem setze ich mich bewusst aus. Grundsätzlich gilt es zu überdenken, wie man sein Leben nach oder mit Corona führen will. Dass wir jetzt aufgerufen werden, auf andere zu schauen, ist ein interessanter Aspekt, auch in Hinblick auf die Kunst. Denn diese Rücksichtnahme auf andere fehlt in unserer Gesellschaft. Meist denkt man nur an Leute im engeren Kreis, weniger an die außerhalb. Wenn man es schafft, das zu verändern: Dann wäre das schon eine gute Lehre aus dieser Zeit. ● ○