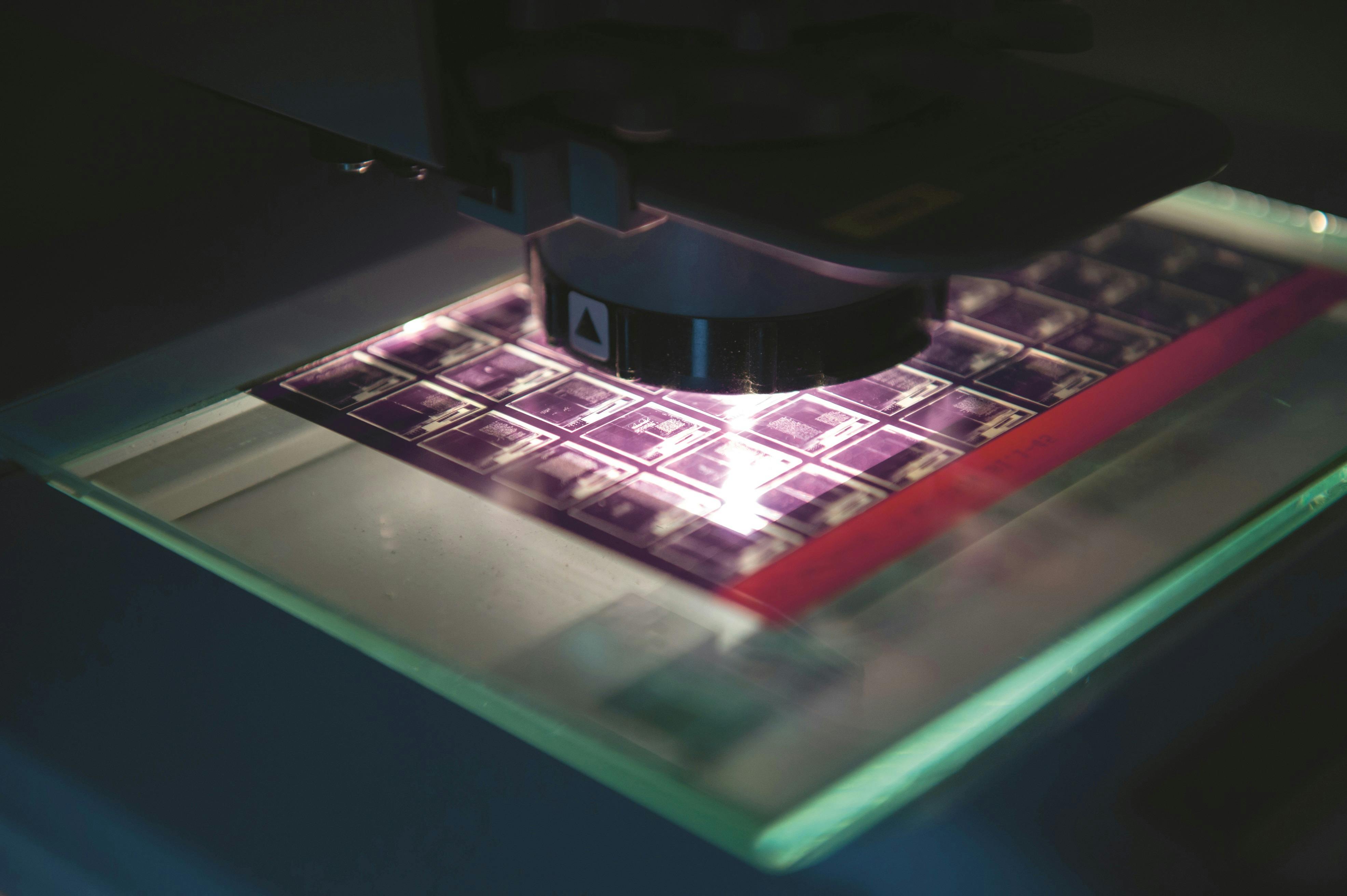Otto Amon sitzt an seinem großen Schreibtisch in seiner Wohnung in Wien-Grinzing und pflegt seinen Stammbaum. Hell leuchten ihm drei große Bildschirme entgegen, sie zeigen Formulare mit vielen Feldern. Ein Name und ein Geburtsdatum aus dem letzten Jahrhundert, es ist der Name seiner vor wenigen Jahren verstorbenen Mutter. „Vor dem Tod der Eltern wirkt das Leben unendlich“, sagt er, ohne den Blick vom Bildschirm zu wenden. Was er nicht sagt: Als seine beiden Eltern starben, hat all dies begonnen. Seitdem interessiert er sich brennend dafür, wer vor ihm kam. Plötzlich habe er seine Vorfahren „kennenlernen“ wollen.
Viele Menschen kennen wohl nicht einmal die Namen ihrer Urgroßeltern. Für Otto Amon dagegen wurde die akribische Suche nach seinen Wurzeln zur Sucht. Immer weiter reiste der ehemalige Handelsattaché dabei in die Vergangenheit – immer verzweigter, immer breiter wurden die Äste seines Stammbaums. Beim Erzählen kommt er vom Hundertsten ins Tausendste. So ist das wohl mit der Ahnenforschung.
1.176 Menschen hat der aus Niederösterreich stammende Hobby-Ahnenforscher in den letzten Jahren gefunden. 1.176 Menschen, von denen er abstammt. 1.176 Menschen, die es geben musste, damit es ihn heute gibt, wie er begeistert erzählt. Das Ergebnis seiner Mühe ist ein meterlanges Dokument, auf dem seine Ahnenreihe aufgezeichnet ist. Er präsentiert es bei Zusammentreffen mit anderen Ahnenforscherinnen und -forschern. Doch diese Treffen sind selten, die Genealogie ist ein eher einsames Unterfangen. Meistens sitzt Amon alleine in seinem Kämmerchen und bastelt an einer selbst programmierten App, mit der er seine Vorfahren digital verwaltet.
Klick. Die Großmutter. Klick. Die Urgroßmutter. Klick. Die Ururgroßmutter. Jeder Mausklick eine Generation, zurück bis zu den Urahninnen. Die Verwandtschaftsbezeichnungen der zeitlich entfernten Verwandten klingen ernst und feierlich.
Aber um die Menge geht es ihm gar nicht, vielmehr interessieren ihn die Leben und Schicksale seiner Ahninnen und Ahnen. Er erfährt nicht nur ihre Namen, sondern auch, welche Berufe sie hatten, wen sie heirateten oder woran sie starben. Und wo sie lebten – denn nicht alle Mitglieder seiner seit mehreren Hundert Jahren im nördlichen Weinviertel ansässigen Familie stammen von dort. Sie verteilen sich quer über Europa.
Zum Beispiel Olivio Francesco. Er lebte im 17. Jahrhundert, war ein Venezianer mit einem sehr venezianischen Beruf: Gondoliere. Er folgte einer Stellenausschreibung des Theodor Graf von Sinzendorf. Bei einer Reise nach Venedig war der Weinviertler Graf von den Gondeln so beeindruckt gewesen, dass er vor seiner Burg einen Burggraben samt See anlegen ließ, auf dem sich Olivio Francesco mit zwei Kollegen verdingen durfte. Er blieb und wurde Teil des Stammbaums von Otto Amon.